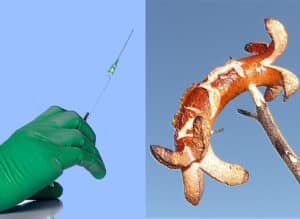»Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit«, schrieb Friedrich Nietzsche über sich selbst in seiner 1888 – also kurz vor dem Beginn seiner geistigen Umnachtung – verfassten Schrift Ecce Homo. Was unbescheiden klingt, hat durchaus einen wahren Kern.
Arne Schimmer
Bis 1945 übte Friedrich Nietzsche einen geradezu ungeheuren Einfluss auf so unterschiedliche Gebiete wie Politik, Musik, Bildende Kunst, Literatur oder Philosophie aus. Der Lyriker und Essayist Gottfried Benn bezeichnete ihn als das »größte Ausstrahlungsphänomen der Geistesgeschichte«. Friedrich Nietzsche wurde am 15. Oktober 1844 in Röcken bei Leipzig geboren und stammte aus einer Familie protestantischer Pastoren.
Er galt als Wunderkind und wurde im Alter von 26 Jahren noch vor Abschluss seines in Bonn und Leipzig absolvierten Studiums der Theologie und alten Sprachen als Professor an die Universität Basel berufen, wo der von ihm hochverehrte Historiker Jacob Burckhardt lehrte.

1872 erschein sein erstes großes Werk Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, in dem er die griechische Antike aus dem Wechselspiel des Apollinischen und Dionysischen interpretierte und er seiner Hoffnung Ausdruck gab, dass es dem Komponisten Richard Wagner gelingen könne, eine Wiedergeburt des Griechentums aus deutschem Geist zu befördern. Vorbildlich war für Nietzsche allerdings vor allem die vorsokratische Epoche des alten Griechenlands zwischen Homer und den Perserkriegen mit ihrer agonalen und vordemokratischen Kultur und ihrer tiefen Verwurzelung im Mythos. Den Vorsokratiker Heraklit bezeichnete er als einen seiner philosophischen »Vorfahren«, der zum Kern seiner eigenen Gedanken führe. Die Welt wird als zielloser Streit der Kräfte begriffen. Er hebt besonders ein Fragment Heraklits hervor: Die Welt sei »Spiel eines Kindes: ein Werden und Vergehen, ein Bauen und Zerstören ohne moralische Zurechnung.«
Dieser Beitrag erschien zuerst in der aktuellen Doppelausgabe unseres Magazins:

Wiedergeburt des Griechentums aus deutschem Geist?
1879 gibt er die Professur in Basel wegen anhaltender Kopf- und Augenschmerzen auf und führt ein unstetes Gelehrtenleben in Deutschland, Italien und der Schweiz. Es entstehen Schriften wie die Morgenröte (1881) oder Die fröhliche Wissenschaft (1882). Hier geht es – in Nachfolge des von ihm sehr bewunderten Florentiner Denkers Niccolò Machiavelli – vor allem auch um Entlarvung und Demaskierung des Maskenspiels der Gutmenschen, die die Berufung auf die Moral in erster Linie zum Ausbau ihrer eigenen Macht nutzen.
Nietzsche als »Arzt der Kultur«
Das Spätwerk ist geprägt durch Titel wie Also sprach Zarathustra (1883 – 85) oder Der Antichrist (1888). Es geht ihm nun um »große Politik« und er scheut auch Begriffe wie »Züchtung«, »Übermensch« und »Wille zur Macht« nicht. Nietzsche begriff sich als »Arzt der Kultur«, der freie, mutige und immateriellen Werten verpflichtete Menschen heranbilden wollte, die ihr Erkenntnisstreben über ein bequemes Leben stellen. Am 25. August 1900 verstarb der große Aphoristiker in Weimar. Seine Wirkungsgeschichte wird sich auch im 21. Jahrhundert fortsetzen, denn in vielen Dingen blickte er weiter in die Zukunft als jeder andere Denker des 19. Jahrhunderts.
Weiterführende Informationen:
Hölderlin – Dichter der prophetischen Anrede an sein Volk
ANTON BRUCKNER – Die Übertragung des Nibelungen-Stils auf die Sinfonie
Frank Kraemer: „Mentale Fundamente. Rechte Kriegerphilosophie wider die Sklavenmoral“