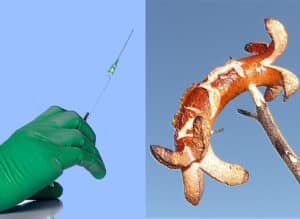Am 20. März 1770 erblickte im schwäbischen Lauffen am Neckar Johann Christian Friedrich Hölderlin das Licht
der Welt. Die Frage, ob uns Hölderlin 250 Jahre nach seiner Geburt heute noch etwas zu sagen habe, würde der als ausgewiesener Hölderlin- Kenner geltende Schriftsteller und Philologe Wilhelm Michel eindeutig bejahen, bezeichnete ihn dieser doch als „Dichter der prophetischen, nicht der unmittelbar zeitgestaltenden Anrede an sein Volk.“
Hölderlin, der früh seinen Vater verlor, besuchte, dem Berufswunsch seiner Mutter folgend, Pfarrer zu werden, zuerst die niedere Klosterschule in Denkendorf bei Nürtingen und dann die höhere Klosterschule in Maulbronn. Daraufhin folgte von 1788 bis 1793 ein Theologiestudium im Tübinger Stift, wo er unter anderem Schelling und Hegel kennenlernte, und den Dichterbund mit Neuffer und Magenau ins Leben rief.
Hölderlin trieb es aber weniger zum Priesteramt als er sich vielmehr zum Dichter berufen fühlte. Allerdings konnte er sich nicht ausschließlich der Lyrik verschreiben, sondern war als Hauslehrer für Kinder wohlhabender Eltern tätig. 1796 trat er eine Hofmeisterstelle im Hause des Frankfurter Bankiers Jacob Friedrich Gontard an, zu dessen Frau Susette Gontard Hölderlin in leidenschaftlicher Liebe entbrannte. Die Erwiderung dieser Gefühle führte 1798 auch zu Hölderlins fristloser Entlassung. Susette Gontard wird nicht nur zur Schlüsselfigur seines Lebens, sondern auch seiner Dichtung, in der sie als Diotima unsterblich wiederkehrt, sowohl in seiner Lyrik, wie auch in seinem berühmten Briefroman Hyperion. Hölderlin selbst beschreibt seine Angebetete, die Zeitgenossen zufolge selbst nach der Geburt von vier Kindern noch mit außerordentlicher Schönheit gesegnet gewesen sei, in einem Brief an seinen ehemaligen Tübinger Studienfreund Christian Ludwig Neuffer wie folgt:
„Es gibt ein Wesen auf der Welt, woran mein Geist Jahrtausende verweilen kann […]. Lieblichkeit und
Hoheit, und Ruh und Leben, umd Geist und Gemüth und Gestalt ist Ein seeliges Eins in diesem Wesen.“
Bis er sich 1802 wieder in seinem Elternhaus einfand, zog es Hölderlin in seiner Hauslehrertätigkeit in diverse Städte. Bereits zwei Jahre später befand er sich aber für 24 Monate in einer Tübinger Heilanstalt, ehe ihn, dem Wahnsinn diagnostiziert wurde, das Tischlerehepaar in einem Zimmer in ihrem Turm in Pflege nahm – für 36 lange Jahre. Am 07.06.1843 stirbt Friedrich Hölderlin im Alter von 72 Jahren. Sein Grab befindet sich auf dem Stadtfriedhof von Tübingen.

Dontworry / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)
Einer der ganz Großen
Mit einer Dissertation von Norbert von Hellingrath im Jahr 1910 und einem Wiederentdecken durch den Lyriker Stefan George setzte sowohl die wissenschaftliche Erschließung, als auch die literarische Nachwirkung Friedrich Hölderlins ein. Zurecht, denn er muss zweifelsohne zu den ganz Großen seines Genres gerechnet werden. Nicht ohne Grund konnten sich kulturelle Größen wie der Dichter Rainer Maria Rilke oder die Philosophen Friedrich Nietzsche und Martin Heidegger an Hölderlin begeistern. Sein oftmals melancholischer Geist, der nachfolgende Köpfe zu so tiefem Nachsinnen über Seinsfragen anregte, schweifte in nahezu endlose Weiten, die hellenistische Klassik ebenso wie die deutsche Romantik um- und erfassend. Paul Wiegler bezeichnete ihn als „der ewigen Grillenfänger“, wobei dieser spielerische Begriff nicht über die Ernsthaftigkeit Hölderlins Gedankenwelt hinwegtäuschen sollte. Wenngleich er sich auch nicht zum Pfarrersamt berufen sah, verkörperte sich in ihm im gewissen Sinne ein Dichterpriester, einer dem sich die Welt in polytheistisch- naturverbundener Schönheit zeigte.
Dieser Beitrag stammt aus dem „Taschenkalender des nationalen Widerstandes“ für das Jahr 2020, erschienen im DS-Verlag. Mit einem Abonnement der DEUTSCHEN STIMME ermöglichen Sie uns die Herausgabe weiterer Buchproduktionen. Das Abo ist das wirtschaftliche Rückgrat des Verlages. Jetzt hier abonnieren: https://bestellung.deutsche-stimme.de/de/
Hölderlins Denken entspricht frühgriechischer Naturphilosophie. Natur ist nicht mit dem Geist verfeindet, und was beide verbindet, kommt in der Schönheit zum Erscheinen. Des Menschen Vernunft ist für Hölderlin keinesfalls etwas, das er gegen die Natur besitzt, sondern er hat sie aus ihr und mit ihr. Aus bloßem Verstand ist nie Verständiges, aus bloßer Vernunft ist nie Vernünftiges gekommen.
„Grundgefühl des Daseins“
Hölderlin`sche Gedankenlyrik oder Philosophie ist das Bestreben, aus einer Totalanschauung dem einzelnen sein Recht zu geben und von allem einzelnen die Erlösungslinie zur Totalverknüpfung zu ziehen. „Hölderlins Dichtung atmet ein Grundgefühl des Daseins“, schrieb oben genannter Wilhelm Michel. Ein Charakteristikum, das Martin Heidegger an Hölderlin fasziniert haben wird.
Dieser „Grillenfänger“ (P. Wiegler) eignet sich jedoch nicht allein für weltentrückt, müßiggängerische Schwarmgeister, sondern appelliert auch an den Tatmenschen, indem Hölderlin das unverwirklichte Leben als Erfahrung des Nichts ausmacht. Seinsdürre kennzeichnet das unverwirklichte Leben. In der Elegie „Brot und Wein“ besingt er die erfüllte Kultur als gleichbedeutend mit dem bewussten, dankenden Bekenntnis zu den Seinsmächten und dessen tätiger Auswirkung im Bereich der Lebensgestaltung. Diese Seinsmächte verkörperten sich ihm in den Göttern. „Hölderlin hat die Götter geliebt, d.h. er hat die mit Geist und Dank erspürten Natur- und Schicksalsmächte mit persönlichen Herzkräften geliebt“, schreibt Michel. Es handelt sich dabei um eine Schicksalsfrömmigkeit gegenüber einem Schicksal, das den Guten nicht verlässt, so lange er sich nicht selbst verlässt, und unrühmlich an sich verzweifelt. Letzteres mag bei ihm selbst vielleicht der Fall gewesen sein, als ihn 1802 die Nachricht vom Tode Susette Gontards, seiner vergöttlichten Diotima, erreichte.
Anrede an sein Volk
Was war aber nun die anfangs genannte Anrede an sein Volk? In Hölderlins – des Propheten der Götterwiederkehr – Dichtung bewirkt sich eine religiöse Zusammenschau des antiken und neuzeitlichen Europas in Form einer veredelten Renaissance vormaliger Begebenheit insofern, dass die alten Götter keiner Verteufelung unterliegen und der Apostelgott keiner Naturfeindlichkeit mehr unterliegt.
Überhaupt behält alle Vergangenheit für Hölderlin eine mythische Gegenwart. Lebensvoll formuliert Hölderlin die geschichtsbiologische Zuversicht, dass aus einem unverändert gebliebenen Naturgrund, der die hellenische Kultur trug, künftig eine abendländisch- deutsche Blütezeit hervorgehen werde. Der Genius Griechenlands war nach ihm nicht untergegangen, sondern als zeugende Kraft zu erneuter Schöpfung weitergewandert. Insbesondere Hölderlins späte Elegien und Hymnen, wie beispielsweise „Archipelagus“ oder „Gesang des Deutschen“ feiern eine vom Schicksal verwaltete Zueinanderordnung Griechenlands und Deutschlands. Der Archipelagus kann als Prophezeiung gelesen werden, dass in Hesperien diese Frucht aus der alten Wurzel – in Hölderlins Sprache: der beiderseitig gemeinsamen Seinsvoraussetzungen – noch einmal reifen werde.

Hölderlin empfand eine Schicksalsgemeinschaft mit dem antiken Menschen insofern, dasss wesentliche Elemente dessen Mythos ihm eigene Wirklichkeitserfahrung waren. Er strebte danach, eine Brücke zwischen altem Mythos und ewigem Sinn zu schlagen, den Nachweis der Zusammengehörigkeit Mythos und Naturwirklichkeit zu erbringen. Hölderlin dachte das „Lebendigstewige“ in Verknüpfung mit dem Zeitlichen. Sein Dichten ist wesentlich Erinnerung und Gedächtnis im Sinne von wiederholend festhaltendem Bewusstsein. Wer weiß, ob nicht auch Friedrich Nietzsche bei seinem Gedanken der ewigen Wiederkehr diesen Aspekt mit im Sinn hatte.
Volk und Seelenregung sind Elementarkräfte
In seiner Ode „Stimme des Volkes“ wird deutlich, dass das Volk und seine Seelenregung als Elementarkräfte verstanden werden. Im übrigen ist für Hölderlin das kollektive Analogon zum Individuell- Genialen und Originalen – im besten Wortsinne Ursprünglichen – ohnehin das Vaterländische, das in unserer besonderen Natur-Art begründet liegt. Den mit dieser Originalität verbundenen Genie-Gedanken beschreibt Hölderlin mit einem Hinweis auf das „Reinentsprungene“: „So viel auch wirket die Noth, Und die Zucht, das meiste nemlich Vermag die Geburt, Und der Lichtstrahl, der Dem Neugebornen begegnet.“ (Rheinhymne).
Bekannt ist Hölderlin neben seinem post mortem veröffentlichten Tragödienfragment „Empedokles“ hauptsächlich für seinen „Hyperion“, der in vielerlei Hinsicht auch als Lebenshermeneutik seines Autors gelesen werden kann. Der philhellenische Briefroman, dessen Bedeutungsgehalt der inneren Handlung, den der äußeren, nämlich der Befreiung Griechenlands vom osmanischen Joch, noch übertrifft, beschwört in seinen Schlusssätzen im lyrischen Stil Hegels dialektische Methode als Versöhnung in einer höheren Einheit nach vorangehender Entzweiung in Gegensätzen. Er stellt am Exempel des Romanhelden einen charakterlichen Entwicklungsroman dar, gesellschaftlich einen Befreiungsroman. Kein Geringerer als Clemens Brentano empfahl 1814 den „Hyperion“ als „eines der trefflichsten Bücher der Nation, ja der Welt.“
Im Empedokles entwirft Hölderlin das Bild eines Ausnahmemenschen, wie es nach ihm vielleicht nur Nietzsche mit seinem Zarathustra vollbrachte. Es handelt sich um ein Weihespiel über den legendären Philosophen, Arzt, Dichter und Politiker Empedokles aus Agrigent, der sich im 5. Jahrhundert vor Christi Geburt, von seinen Mitbürgern verbannt, in den Ätna gestürzt haben soll. Im Gegensatz zur Figur des Hyperion, der als Werdender dargestellt ist, steht Empedokles als Persönlichkeit in seinem Schicksal. Der klassischen Dramentheorie folgend machte sich Empedokles dadurch schuldig, das Geschenk der Götter für eigenwüchsige Begabung zu halten, was zur Heilung sein Selbstopfer erforderte. Hierin zeigte sich Hölderlins Widerspruch zum modernen Menschen, der sich in hybrider Selbstermächtigung aus allen naturhaften Abhängigkeiten emanzipieren zu können einbildet.
Priester der Volksgemeinschaft
Hölderlin übersetzte auch die alten Griechen und war ein glühender Verehrer von Sophokles und insbesondere Pindar. Pindar verhalf ihm zur Freilegung seines eigenen Hymnenstils und Entfaltung eines Bewusstseins des Dichters als priesterlichem Diener an der Volksgemeinschaft.
Der pindarische Dreiklang von Hymnik (Götteranrufung), Gnomik (Spruchweisheit) und Enkomiastik (Heldenlob) ist in Hölderlins Dichtung wiederauferstanden, und dies in freien Rhythmen, wie sie im deutschen Schrifttum unvergleichlich sind. Hölderlin war jedoch keineswegs ein unschöpferischer Epigone ohne eigene stilbildende Kraft. In der Hymne „Die Wanderung“ oder der Dichtung „Die Heimkunft“ lehrt Hölderlin, dass die Auswanderung ins Fremde nur eine Abstandnahme darstellt, die das Eigene erst innig zum Eigentum macht. Er erkennt auch die jeweilige Meisterschaft von Griechen und Nordländern in ihrer aufeinanderzulaufenden Entwicklung. Die Griechen vom Enthusiasmus zur Besonnenheit und die Nordländer von Nüchternheit zur Leidenschaft.
In Hölderlins Werk spiegelt sich die Hoffnung auf hesperische Wiedergeburt griechischer Schönheit durch eine Anrufung an die hold dienenden Genien der Anmut, die – wie es Wilhem Michel ausdrückt – „in aller Kunst- und Naturschönheit das Element des eigentlichen Reizes verwalten, das Element der seelischen Berührung, womit sie im griechischen Mythos zu Repräsentantinnen der verfeinerten Menschenseele überhaupt werden“. – Wenn dem heutigen Leser in seiner Sehnsucht nach Sinnenglück und Seelenfrieden diese hesperische Wiedergeburt des Abendlandes unerreichbar fern erscheinen mag, so tröste ihn das Hölderlin-Wort: „Lang ist die Zeit, es ereignet sich aber das Wahre.“
Sascha A. Roßmüller