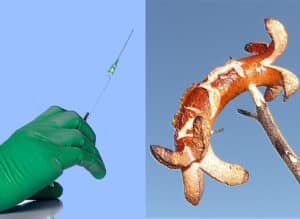Peter Mitterhofer, eigentlich gelernter Zimmermann und Tischler, konstruierte mehrere Schreibmaschinen-Typen.
Lutz Dessau
Im Jahr 1873 begann der US-amerikanische Industrielle Philo Remington (1816-1889) mit der ersten Schreibmaschinen-Fabrikation. Seitdem trat der über Drucktypen und zunächst per Hand betriebene Apparat seinen Siegeszug durch die Welt an, wobei die Grundlagen nicht etwa in den Vereinigten Staaten geschaffen worden sind. Ausgangspunkt der Entwicklungsgeschichte war der Vinschgau in Südtirol, genauer die Gemeinde Partschins, wo am 20. September 1822 ein Bub namens Peter Mitterhofer das Licht der Welt erblickte. Sein Vater unterrichtete ihn im Zimmermanns- und Tischlerhandwerk. Des Sohnes Talent erstreckte sich indes nicht nur auf den handwerklichen, sondern auch auf den musikalischen Bereich. Beides kombinierte er, indem Mitterhofer seine Instrumente selbst fertigte: neben einer Gitarre baute er eine »Raffele«, eine dreisaitige alpenländische Urform der Zither.

Wie es sich für einen Zimmermann von echtem Schrot und Korn gehört, ging er bald nach Abschluss der Lehrzeit auf die »Walz«, die ihn nach Wien, aber auch durch Deutschland, Frankreich, die Schweiz und sogar bis auf die Balkanhalbinsel führte. Während der Wanderschaft dichtete er lustige Verse, die »Schnadehupferl«, die der mit einer guten Singstimme versehene Mittermeier bei jeder Gelegenheit zum Besten gab.
Nach seiner Rückkehr arbeitete Mitterhofer weiter als Zimmermann. Bei den Dorfgenossen galt er als Sonderling, der in Gasthäusern als Musikant, Sänger und Bauchredner auftrat und sich schon gern mal mit der Obrigkeit in Gestalt des Gendarmen anlegte. Und: Peter Mitterhofer tüftelte ständig. Resultate seiner kreativen Tätigkeit waren eine Schubkarre, die auch als Rückentrage Verwendung finden konnte, sowie eine Waschmaschine.
Weiterführende Informationen:
Der »Eiserne Kanzler« und der Traum vom Reich
Zarathustras Flüche gegen Herdentrieb und Gleichheitswahn

Ab 1864 widmete er sich der Entwicklung von Schreibmaschinen. Experten vermuten, dass ihn eines der von ihm gebauten Instrumente, der »Hölzerne Glachter«, dazu inspirierte. Denn bei jener klavierähnlichen Apparatur schlagen Hämmerchen auf Holzblättchen – im Fall der Schreibmaschine schlägt der Typenhebel aufs Farbband, wodurch das Schriftzeichen auf das auf der Walze befindliche Papier »gedruckt« wird.

Mitterhofers Schreibmaschinen-Modelle wurden mit einfachen Werkzeugen gebaut. Das erste Produkt nannte er »Wiener Modell 1864«, ein Prototyp, der nie fertiggestellt wurde und der sich heute im Technischen Museum Wien befindet. Der zweiten Maschine gab er den Namen »Dresdner Modell«, das heute zum Bestand der Technischen Sammlungen der Stadt Dresden gehört. Diese Modelle bestanden noch vorwiegend aus Holz. In das dritte Modell – es ist nicht mehr auffindbar – integrierte Mitterhofer eine Schreibwalze. Die nächsten, nunmehr metallenen Prototypen waren das »Meraner Modell 1866« (mit Groß- und Kleinschreibung sowie Ziffern versehen) und das »Wiener Modell 1869«. Beide brachte Mitterhofer nach Wien. Das Resultat indes war niederschmetternd, da die Gutachter am Polytechnischen Institut in Wien den Wert der Maschinen nicht erkannten.
Am 27. August 1893 starb Peter Mitterhofer, tief enttäuscht über die mangelnde Anerkennung seiner Erfindungen, in Partschins. Schließlich wurde ihm – wenn auch recht spät – eine Ehrung zuteil: Seit 1998 gibt es in Partschins ein nach ihm benanntes Schreibmaschinen-Museum, in dem eine Sammlung von über 1200 Exponaten aus aller Welt zu bestaunen ist.
Weiterführende Informationen:
Carl Thiersch – Forscher und Praktiker
Franz Joseph I.: Ein Kaiser als Mythos
»Das Wohl meines Volkes und meines Reiches war das Ziel meines Handelns«