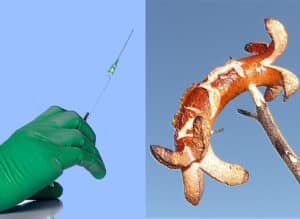Zum 205. Geburtstag: Otto Eduard Leopold Fürst von Bismarck (1815 – 1898), preußisch-deutscher Staatsmann und 1. Reichskanzler
Die heutige Geschichtsschreibung scheint von dem Gedanken beseelt, jede Persönlichkeit der deutschen Geschichte »entthronen« zu wollen. Die mehr als kritische, ja schon destruktiv zu nennende Distanz zum eigenen Volk und Geringschätzung der eigenen Geschichte zwingt geradezu eine »Entzauberung« herausragender Persönlichkeiten herbei.
Peter Schreiber
Davon bleibt auch die Erinnerung an Bismarck, den »Eisernen Kanzler«, nicht verschont. So können sich zeitgeist-konforme Darstellungen im besten Falle zu dem Fazit durchringen, es habe sich bei Bismarck um »eine der schillerndsten Persönlichkeiten der deutschen Geschichte« gehandelt. Immerhin: Auch heutige Darstellungen kommen nicht umhin, nicht nur Bismarcks Kriegspolitik zu erwähnen, mit der Preußen die unangefochtene Vormachtstellung in Kontinental-Europa erlangte. Auch seine Rolle als Volksheld, Gründervater und erster Kanzler des Deutschen Reiches lässt sich nicht leugnen, ebenso wenig wie seine herausragende Rolle bei der nationalstaatlichen Einigung Deutschlands. Genau das schafft aber die Distanz der herrschenden Meinungsmacher zum »Mythos Bismarck«. Gilt es doch, nicht nur den deutschen Nationalstaat, sondern überhaupt den Gedanken der Nation abzustreifen wie einen lästigen, angestaubten und angeblich zu eng gewordenen Rock. Daß nicht nur »Blut und Eisen« das Wesen und die Politik des Menschen und Kanzlers kennzeichnete, sondern eben auch Diplomatie und Augenmaß, wird für jeden deutlich, der sich eingehender mit Bismarcks Werdegang und Politik beschäftigt.
Kindheit, Jugend und Reifejahre
Am 1. April 1815 wird Otto von Bismarck in Schönhausen, also in der Mark Brandenburg, geboren. Schönhausen liegt in der Nähe von Stendal, also auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Die Zeit, in die der kleine Otto hineingeboren wird, ist jene bewegte Epoche der Restauration, die nach dem endgültigen Sturz Napoleons I. mit der Neuordnung Europas durch den Wiener Kongress eingeläutet wurde. Otto von Bismarck ist das vierte Kind und der zweite Sohn des Rittmeisters a.D. und Gutsbesitzers Ferdinand von Bismarck. Seine Mutter Wilhelmine, eine geborene Mencken, entstammt einer angesehenen Gelehrtenfamilie, ihr Vater war Kabinettsrat der Könige Friedrich Wilhelm II. und Friedrich Wilhelm III.
Beide Linien, so sollte sich erweisen, ergänzten sich und vollendeten sich im Sohne: Hier die Tradition eines altpreußischen, märkischen Uradels – also die harte, geerdete Haltung des Landjunkers, dort die geistige Beweglichkeit des Bildungsbürgertums. Entschlossenheit und Willensstärke, gepaart mit Gedankenreichtum, das waren die beiden Hauptströme, die in Bismarck wirkmächtig wurden und ihn dazu befähigen sollten, Geschichte zu schreiben.
Doch zurück zu den Anfängen: Otto verlebt seine Kindheit auf dem Familiengut Kniephof bei Naugard in Pommern, was sich durchaus prägend auf seinen Charakter auswirken sollte, da ihm selbst zu späteren Zeiten eine starke Naturverbundheit erhalten blieb, was auch in seiner Sprache zum Ausdruck kommt, wie auch ein tiefgehendes Verständnis für die Landwirtschaft und deren Bedeutung für ein funktionierendes Staatswesen. Letzteres kommt etwa in folgendem Zitat zum Ausdruck: »Wenn die Landwirtschaft nicht besteht, kann auch der Staat nicht bestehen.«

Quelle: Von Autor unbekannt – Photo: Richard Carstensen. Bismarck anekdotisches. Muenchen: Bechtle Verlag. 1981. ISBN 3-7628-0406-0, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11708075
Seine Schulzeit verbringt Otto von Bismarck zunächst auf der Privatschule der Plamannschen Anstalt (1822 – 1827), ein Berliner Internat, danach besucht er das Friedrich-Wilhelm-Gymansium und das Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin, um schließlich im Jahre 1832 als gerade einmal 17-jähriger diese mit dem Abitur abzuschließen. Insbesondere der erste Abschnitt, seine Internatszeit, sollte Bismarck prägen. Die genannte Lehranstalt war aus dem Geist des großen Schweizer Pädagogen und Sozialreformers Johann Heinrich Pestalozzi hervorgegangen. Hier hatte schon Karl Friedrich Friesen, der spätere Führer des Lützowschen Freikorps, gelehrt, wie auch »Turnvater« Jahn. Es habe, so Bismarck später, »künstliches Spartanertum« geherrscht, »viel Zwang und Dressur«, und die Lehrer seien »demagogische Turner« gewesen, »welche den Adel hassten«, wie Bismarck voller Abscheu im Rückblick konstatiert.

Nach seiner Schulzeit, in der er umgeben ist von den Söhnen hoher preußischer Beamter, studiert Bismarck Rechtswissenschaften an der hannoverschen Universität Göttingen. Allerdings widmet sich der junge Student Bismarck in dieser Zeit mehr diverser Streiche und Kneipenerlebnisse im Rahmen des exklusiven »Corps Hannoverana«, als dem eigentlichen Studium. Lediglich der Staatsrechtler und Historiker Heeren vermag Bismarck für seine Vorlesungen zu begeistern. Während die meisten seiner Altersgenossen noch im politischen Denken der Biedermeierzeit verhaftet sind, vermag Heeren in Bismarck den Blick für die internationalen Zusammenhänge der Politik zu schärfen und dessen Horizont über Preußen und den Deutschen Bund hinaus zu erweitern. Zum ersten Male scheint zu dieser Zeit in dem jungen Bismarck das Bewusstsein seiner eigenen Mission auf, als er 1834 – im Alter von 19 Jahren – an einen Jugendfreund schreibt: »Ich werde entweder der größte Lump oder der größte Mann Preußens.« Er sollte einer der Größten für die Geschicke Deutschlands und Europas werden, und wird er seinerzeit gefragt, was er denn studiere, so gibt er nicht etwa das Studium der Rechtswissenschaften an, sondern gibt schlicht zur Auskunft: »Diplomatie«.
Schließlich kehrt Bismarck jedoch zum väterlichen Landgut nach Pommern zurück, obwohl die Aachener Regierung ihm die Fortsetzung seines Dienstes in Potsdam empfohlen hatte. Ausschlaggebend ist jedoch der frühe Tod der Mutter Anfang 1839, der Bismarck dazu bewegt, dem Staatsdienst den Rücken zu kehren, das Studium nicht zu beenden und stattdessen das Landgut gemeinsam mit seinem Bruder Bernhard zu bewirtschaften. Damit hat er sich keine leichte Aufgabe gestellt, waren die väterlichen Güter doch hoch verschuldet. Durch kluges Wirtschaften, aber auch durch Neuerungen gelingt es ihm, das ländliche Gut wieder hochzubringen. Er begnügt sich nicht damit, sondern arbeitet mit in der ländlichen Selbstverwaltung als Kreisdeputierter in Pommern, wie auch als Deichhauptmann in Schönhausen und wirkt mit an der Reform der gutsherrlichen Gerichtsbarkeit. Was für andere sinnerfüllend gewesen und eine Lebensaufgabe dargestellt hätte, das lässt Bismarck innerlich leer. So nutzt er diese Jahre, in denen er »nichts zu tun hatte«, um unendlich viel zu lesen: geographische und historische, politische und philosophische sowie theologische Werke. Er beschäftigt sich mit Spinoza, Voltaire, Kant oder Ludwig Feuerbach, studiert die deutsche und englische Literatur, wobei er Shakespeare und Byron den Vorzug gibt. In dieser Zeit erwirbt Bismarck sich das historische Wissen und die sowohl theoretischen als auch rhetorischen Grundlagen für sein späteres Wirken als Redner und Staatsmann. Ohne diese autodidaktischen Studien wäre er nicht zur Kunst des treffenden historischen Vergleichs fähig gewesen und nicht zu jener plastischen Darstellung, die ihm in der politischen Auseinandersetzung dann zugute kamen.
Trotzdem genießt der den körperlichen Freuden durchaus zugetane Bismarck auch das feudale Leben als wohlhabender Landjunker, doch erfüllt es ihn auch? Oft reitet der zur Verwegenheit neigende Bismarck aus, ergeht sich in wilden Gelagen mit Freunden oder mit seiner Nachbarschaft oder stillt seine Abenteuerlust auf Reisen nach Schottland, England und Frankreich; der »tolle Bismarck«, wie ihn bald viele nennen, spielt sogar mit dem Gedanken, nach Asien zu reisen oder unter englischer Fahne Kriegsdienst zu leisten, nur um seinem Leben Sinn und Inhalt zu schenken.
Offenbar fehlt ihm etwas,- der tiefere Sinn in seinem Leben, ein Beruf, der ihn wirklich auszufüllen vermag, die Frau, die ihm eine gewisse Häuslichkeit und familiäre Geborgenheit zu schenken bereit ist? Bismarck selbst betrachtet sein bisheriges Leben als »willenloses« Treiben »auf dem Strom des Lebens«, so dass es erst einer religiösen Begegnung bedurfte, um den inneren Kompass neu auszurichten. 1843 kam es zu einer solchen, mit dem Kreis pommerscher Pietisten um die Familien von Blanckenburg, von Thadden und von Kleist-Retzow. Die Braut seines Freundes Moritz von Blanckenburg, Marie von Thadden, führt mit ihm intensive Gespräche über religiöse Fragen. Dieser Gedankenaustausch, vor allem aber die vorbildliche, aus religiöser Überzeugung gespeisten Haltung der tödlich erkrankten Frau, löst in ihm eine seelische Erschütterung und »Bekehrung« aus, die Bismarck schließlich zu einem zwar undogmatischen, aber christlichen Glauben an Gott führt. In dieser Zeit lernt Bismarck auch Johanna von Puttkamer kennen, um deren Hand er im Dezember 1946 anhält, und die er als »eine Frau von seltnem Geist und seltnem Adel der Gesinnung« beschreibt.
Bismarck sollte sich in all dem nicht getäuscht haben: So, wie seine Ehe mit Johanna, einer tiefreligiösen Protestantin, bis zu deren Tod im Jahre 1894 zu einer unerschütterlichen Grundlage seiner weiteren Existenz wurde, so sollte der von ihm neu gewonnene Glaube seine Dienstgesinnung gegenüber dem preußischen Staat und dessen Monarchen begründen: dem König zu dienen hieß für ihn fortan, zugleich Gott zu dienen. Somit war mit der Beendigung seines ungezügelten, richtungslosen Lebens und mit der Hinwendung zur Liebe seines Lebens und zum Glauben die Grundlage gelegt für den weiteren schicksalhaften Lebensweg Bismarcks in die Politik. Der Ehe mit Johanna von Puttkamer entspringen ihre drei Kinder Marie, Herbert und Wilhelm, die sie gemeinsam großziehen.
Geburt des Politikers Bismarck
Im Februar 1847 schließlich beginnt die eigentliche politische Karriere Bismarcks, als dieser die Berufung als Vertreter der ostelbischen Ritterschaft in den Vereinigten Landtag durch König Friedrich Wilhelm IV. erfährt. Der Vereinigte Landtag stellte eine Vertretung der preußischen Stände dar, und selbstverständlich tritt hier Bismarck, dem konservativen Lager angehörend, als Verfechter der Monarchie auf. Immerhin, auch wenn dieser Landtag zunächst nur zweckgebunden und auf Veranlassung des Königs zusammentrat, so war mit seiner Zusammenkunft bereits der erste Schritt Preußens in die Reihe der Verfassungsstaaten vollzogen.
Und auch wenn Bismarck im Sinne der Monarchie wirkt, so war ihm dennoch klar, dass, wie er schließlich selbst ausführte, »die unumschränkte Autorität der alten preußischen Königsmacht… nicht das letzte Wort« seiner Überzeugung sein konnte. Rückblickend schreibt er später: »Ich bin schon 1847 dafür gewesen, dass die Möglichkeit öffentlicher Kritik der Regierung im Parlamente und in der Presse erstrebt werde, um den Monarchen vor der Gefahr zu behüten, dass Weiber, Höflinge, Streber und Phantasten ihm Scheuklappen anlegten, die in hinderten, seine monarchischen Aufgaben zu übersehen, und Missgriffe zu vermeiden oder zu korrigieren…« Diese später geäußerte, jedoch damals schon in ihm angelegte Auffassung einer gewissermaßen parlamentarischen und öffentlichen Kontrolle des Monarchen, mag ihm den späteren Wechsel seiner Bündnispartner hin zu den Liberalen ermöglicht haben, hindern Bismarck jetzt jedoch nicht daran, im Landtag gegen die liberale Opposition zu Felde zu ziehen, die fortwährend an das von König Friedrich Wilhelm II. gegebene, aber bislang nicht eingehaltene »Verfassungsversprechen« von 1815 erinnert. Auch steht Bismarck im Revolutionsjahr 1848 auf Seiten seines Königs, Friedrich Wilhelm IV., der sich nach der Niederschlagung des Volksaufstandes auch dankbar gegenüber Bismarck zeigt.

Noch einmal zurück ins Jahr 1847 und dessen Auseinandersetzungen um das Verfassungsversprechen. Hierzu gibt der damals erst 32 Jahre alte Otto von Bismarck-Schönhausen in seinen Gedanken und Erinnerungen Auskunft und gewährt uns einen Einblick in die leidenschaftlich geführten Konflikte jener Zeit: „Ich geriet mit der Opposition in Konflikt, als ich das erste Mal das Wort nahm, am 17. Mai 1847, indem ich die Legende bekämpfte, dass die Preußen 1813 in den Krieg gegangen wären, um eine Verfassung zu erlangen, und meiner naturwüchsigen Entrüstung darüber Ausdruck gab, dass die Fremdherrschaft an sich kein genügender Grund zum Kampfe gewesen sein solle. Mir schien es unwürdig, dass die Nation dafür, dass sich selbst befreit habe, dem Könige eine in Verfassungsparagraphen zahlbare Rechnung überreichen wolle. Meine Ausführung rief einen Sturm hervor. Ich blieb auf der Tribüne, blätterte in einer dort liegenden Zeitung und brachte, nachdem der Lärm sich ausgetobt hatte, meine Rede zu Ende.«
Man kann sich bei solchen Worten lebhaft den Tumult im preußischen Vereinigten Landtag und die Empörung der liberalen Opposition vorstellen. Um diese Auseinandersetzungen richtig begreifen zu können, muss man sich vergegenwärtigen, in welcher Lage sich das konservative Lager jener Tage befand, war es doch gar nicht gewohnt, im harten Meinungskampf mit dem politischen Gegner zu bestehen. So hatte sich bereits eine recht vitale liberale und revolutionäre politische Publizistik herausgebildet. Dem hatten die ans Herrschen statt ans Debattieren gewöhnten Konservativen wenig entgegenzusetzen. Einzig Bismarck schien fähig und willens, der liberalen Meinungsführerschaft entgegenzutreten.
Man stellt sich natürlich schon die Frage, wie aus diesem leidenschaftlichen Streiter für das Althergebrachte, diesem Preußen-Bekenner par excellence später der Gestalter der – wenn auch kleindeutschen – Einigung werden konnte. Bismarck: »Preußen sind wir und Preußen wollen wir bleiben…« Wie die Leidenschaft, mit der Bismarck zunächst kompromisslos für die äußere Freiheit und die innere Festigkeit des preußischen Staates kämpfte, schließlich in den Glauben an die deutsche Nation münden sollte, werden wir noch sehen.
Dass Bismarck dem Einigungs- und Verfassungswerk der Frankfurter Paulskirche auch deshalb so ablehnend gegenüberstand, mag seinen Grund in einer tiefen Sorge vor den Gefahren einer deutschen Einigung inmitten feindlich gesonnener Nachbarn gehabt haben. Für Bismarck war klar – wie allen Verfechtern der staatlichen Einigung Deutschlands – dass eine gesamtdeutsche Lösung nur dann möglich wäre, wenn Österreich bereit wäre, seine deutschen Länder aus der staatlichen Gemeinschaft mit den nichtdeutschen zu lösen. Dies wiederum schien undenkbar, weshalb Bismarck früh erkannt haben musste, dass zunächst nur eine »kleindeutsche« Lösung unter Führung Preußens in Betracht käme. Ein solches Reich stünde jedoch im Gegensatz zu einem Österreich, das auf seiner herausragenden Stellung in Deutschland bestünde und nur in einer kriegerischen Auseinandersetzung davon abzubringen wäre. Dazu aber musste Deutschland unter Preußens Führung stark sein, und eine solche Stärke traute Bismarck einer aus dem Paulskirchen-Parlament legitimierten Krone nicht zu: »Die Frankfurter Krone mag sehr glänzend sein, aber das Gold, welches dem Glanze Wahrheit verleiht, soll erst durch das Einschmelzen der preußischen Krone gewonnen werden und ich habe kein Vertrauen, dass der Umguss mit der Form dieser Verfassung gelingen werde.«
Ob Bismarck die Mission Preußens in dem bevorstehenden Einigungsprozess der deutschen Nation zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon in vollem Umfang oder doch im wesentlichen voraussah, wie es oben wiedergegebene Zitate nahelegen, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, da manche von ihm kundgetane Einsicht erst in der Retrospektive geäußert wurde.
Zu Beginn der Revolution jedenfalls, im März 1848, scheint Bismarcks Denken und Handeln von einer einzigen leidenschaftlichen Aufwallung gegen das, was da geschieht, erfüllt. So will er gar zusammen mit seinen Schönhausener Bauern einen Marsch nach Berlin antreten und ruft zum bewaffneten Widerstand gegen die Liberalen auf. Damit schießt er übers Ziel hinaus, denn selbst sein König, Friedrich Wilhelm IV., lehnt ein derartiges Vorgehen ab. Dieser verkündet in seinem Aufruf »An mein Volk und die deutsche Nation« vom 21. März 1848: »Preußen geht fortan in Deutschland auf.«
Bismarck hingegen schließt sich einem ultrakonservativen Kreis um den Generaladjutanten des Königs, Leopold von Gerlach, an und beteiligt sich an der Gründung der ebenso gesinnten Kreuzzeitung, wie auch an der Versammlung des »Junkerparlaments«, »zum Schutz des Eigentums und zur Förderung des Wohlstands aller Klassen«. In Verkennung seiner, freilich erst später stärker zu Tage tretenden politisch-diplomatischen Fähigkeiten, urteilt der König damals über Bismarck: »Nur zu gebrauchen, wenn das Bajonett schrankenlos waltet.«
Wie dem auch sei: Friedrich Wilhelm IV. belohnt Bismarcks politischen Einsatz und entsendet ihn 1851 nach Frankfurt am Main, wo dieser beim Deutschen Bund die Interessen Preußens vertreten soll. Es folgen die für Bismarck und seine Gemahlin glücklichen, acht Frankfurter Jahre (Mai 1851 bis Februar 1859), welche die Familie Bismarck in einer Villa an der Bockenheimer Landstraße in großer Verbundenheit miteinander, und trotz größter Arbeitsbelastung, verbringt.
Politisch gesehen gilt es aus der Sicht Bismarcks, im Deutschen Bundestag, in dem bis 1848 die beiden deutschen Großmächte recht einträchtig zusammenarbeiten, ein Übergewicht Österreichs zu verhindern, das aufgrund seines ungleich höheren Ansehens infolge seines Kaisertums, die Vorherrschaft zu erringen droht. Fast scheint es, als würde der Deutsche Bund unter der Leitung von Fürst Schwarzenberg zum verlängerten Arm Österreichs, während Preußen seine »deutsche Sendung« aufgegeben zu haben scheint. Doch das war dem Nationalgedanken insgesamt abträglich, da der österreichische Nationalitätenstaat niemals dazu in der Lage gewesen wäre, die deutsche Sehnsucht nach staatlicher Einheit zu erfüllen. Aus einer Minderheitenposition heraus versucht daher Bismarck, die preußische Position in der vom Hause Habsburg bestimmten deutschen Gesamtpolitik aufzuwerten, und droht eins ums andere Mal mit „Bundesbruch“, immer den Eindruck erweckend, eine zu allem entschlossene preußische Regierung stünde mit unerschütterlichem Kampfeswillen hinter ihm,- dabei verkörpert er, Bismarck allein, diesen Kampfeswillen.
Im Zuge des Jahre währenden Kampfes Bismarcks um die preußische Vorherrschaft im Deutschen Bund gelingt es ihm dreimal, die zeitweilige Führung zu erlangen und Österreich in die Minderheit zu drängen. Eines dieser erfolgreichen Versuche kennzeichnet eine historische Parallele mit der gegenwärtigen geopolitischen Lage in Europa. Zum einen gelingt es Bismarck, mittels einer neuen Geschäftsordnung die präsidialen Machtbefugnisse im Bundestag zurückzudrängen, um somit die eigene Stellung zu stärken. Zweitens – und hier ist die historische Parallele – wehrt Bismarck den Versuch Österreichs ab, während des Krimkrieges den Deutschen Bund zur Aufgabe seiner Neutralität zu bringen und an Österreichs Seite gegen Russland in den Krieg zu ziehen. Bismarck ist aber klar, dass dies gegen deutsche und preußische Interessen verstoßen würde; auch die im Bund zusammengeschlossenen deutschen Klein- und Mittelstaaten konnten Bismarck und Preußen dankbar dafür sein, nicht in die kriegerischen Belange der Donau-Monarchie hineingezogen worden zu sein. Drittens gelingt es ihm, die gegenüber allen anderen Bundestagsgesandten stark herausgehobene Stellung des österreichischen Präsidialgesandten zurechtzustutzen. Bei allen seinen politischen Schachzügen muss Bismarck dabei auch ganz Diplomat der eigenen Regierung gegenüber sein; nicht immer hat man dort auf Anhieb ein Einsehen mit seinen taktischen und strategischen Überlegungen.
Als 1858 der liberal gesinnte Prinz Wilhelm I. von Preußen die Regierungsgeschäfte von seinem erkrankten Bruder übernimmt, erkennt Bismarck darin eine neue Gefahr: Ihm ist klar, dass der neue Regent nicht auf Konfrontationskurs mit Österreich gehen möchte und schickt ihm daher eine mahnende Denkschrift, in der er die nationale Idee beschwört und aufzeigt, welche Bedeutung eine Machtexpansion Preußens für die Verwirklichung der staatlichen Einheit haben würde.
Ein Bismarck lässt sich nicht kaltstellen
Wilhelm I. reagiert leider nicht so, wie Bismarck sich das erhofft hatte. Allerdings ist die Dankbarkeit gegenüber Bismarck und dessen Verdienste um die preußische Monarchie zu groß, als dass man ihn einfach so hätte abservieren können oder wollen. Trotzdem wird der dickköpfige Junker – so scheint es – zunächst kaltgestellt. Wilhelm schickt ihn für einige Jahre als preußischen Gesandten zunächst nach St. Petersburg, später nach Paris. Doch nachdem Bismarck im Januar 1859 am Hof in St. Petersburg eintrifft, beginnt für ihn, für Preußen und für den Gedanken eines deutschen Nationalstaates eine schicksalhafte Zeit. Wenn 1862 Bismarck wieder zurückkehrt, wird er eine Bedeutung erlangt haben, wie nie zuvor.
Doch der Reihe nach. In seiner Rolle als preußischer Botschafter kann Bismarck dort die Beziehungen zum zaristischen Russland auf eine Weise pflegen, wie ihm dies vorher nicht möglich gewesen war. Er selbst freilich empfindet die Abordnung nach St. Petersburg als jene Kaltstellung »an der Newa«, als die sie wohl auch gedacht war: So erkrankt er noch im Januar 59 an einer Grippe, war mehrere Tage – er, dessen Frau sonst von ihm sagte, er habe eine »Löwengesundheit« – ans Bett gefesselt und kennt natürlich den Grund dafür: »Gallenfieber über Petersburg« – also Kummer über seine Versetzung. Doch Bismarck nutzt die Zeit, und als er im April 1859 dem russischen Zaren Alexander II. gegenübertritt, weiß man dort bereits, dass ein politischer Freund angekommen ist. In diesem Sinne sollte Bismarck fortan wirken, und bereits an 4. April 1859 kann er seiner Frau Johanna schreiben: »Wie die Österreicher hier drunten durch sind, davon hat man gar keine Idee, kein räudiger Hund nimmt ein Stück Fleisch von ihnen… Erst seit ich hier bin, glaube ich an Krieg; die ganze russische Politik scheint keinem anderen Gedanken Raum zu geben als dem, wie man Oestreich ans Leben kommt.«

Um es abzukürzen: Infolge der Bismarckschen Politik und der Nicht-Teilnahme am Krimkrieg gegen Russland war Preußen mit Russland, Frankreich und England »befreundet«, während Österreich mit Russland über Kreuz lag, Frankreich zu fürchten und von England zumindest nichts zu erwarten hatte. Preußens Stellung in Europa ist seit dem Krimkrieg der österreichischen folglich überlegen. Im Deutschen Bund selbst ist Österreich nach wie vor dominant, zumal die deutschen Klein- und Mittelstaaten die starke Stellung Preußens fürchten. Preußen selbst hat von einer denkbaren Zerschlagung des Deutschen Bundes mehr zu gewinnen als zu verlieren, weshalb Bismarck später, als Ministerpräsident, eine entsprechende Drohung im Jahre 1862 zum wiederholten Male ausspricht und 1866 schließlich wahrmacht.
Wäre es nach ihm gegangen, so hätte Bismarck schon 1859, als Österreich sich im Krieg mit Frankreich und Sardinien befand, die Gelegenheit genutzt, um Österreich ganz aus Deutschland herauszudrängen und ein deutsches Königreich zu gründen. Doch da der neue Prinzregent Wilhelm eine solche Politik ablehnt und lieber »moralische Eroberungen« in Deutschland machen will, als Krieg zu führen, wird Bismarck in jenen diplomatischen Dienst versetzt, der ihm allerdings die Gelegenheit geben sollte, sein späteres Einigungswerk außenpolitisch vorzubereiten.
Die als »Neue Ära« bezeichnete Politik des Prinzregenten Wilhelm, eine Regentschaft, die dieser für König Friedrich Wilhelm IV. übernommen hatte, und die bis ins Frühjahr 1862 angedauert, endet mit einem inneren Verfassungsstreit, der sich zwischen König, Regierung, Abgeordnetenhaus und Militär zu diesem Zeitpunkt gefährlich zuspitzt. Es geht dabei um die Kontrolle über die Armee, über die der König die Kommandogewalt behalten will und um haushaltspolitische Kompetenzen. In dieser Lage tritt Bismarck als »Retter« auf, indem er sich gegenüber dem König bereit erklärt, notfalls auch gegen das Abgeordnetenhaus zu regieren, woraufhin er vom Regenten zum Ministerpräsidenten ernannt wird.
In seiner berühmten »Blut und Eisen«-Rede, die er vor dem wichtigsten politischen Gremium, der Budgetkommission des preußischen Landtages, hält, sagt Bismarck: »Nicht auf Preußens Liberalismus sieht Deutschland, sondern auf seine Macht… Preußens Grenzen nach den Wiener Verträgen sind zu einem gesunden Staatsleben nicht günstig. Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden große Fragen der Zeit entschieden, …sondern durch Eisen und Blut.« Damit hat Bismarck seine Karten auf den Tisch gelegt: Krieg scheint für ihn das passende Mittel, um die Vorherrschaft Preußens zu erlangen. Die Notsituation des Königs erkennt man, indem man sich die Haltung der Konservativen vor Augen führt, die einer der herausragenden Historiker und politischen Publizisten seiner Epoche deutlich beschreibt: »Ein Parlament, welches die Kriegsmacht befehligt, ist der Krone Sturz.«
Preußens Stärke für Deutschlands Traum
In dieser Lage kann Bismarck, mit seinen weitreichenden Kompetenzen als preußischer Ministerpräsident, das immer stärker werdende nationale Bewusstsein des deutschen Volkes dafür nutzen, seine Politik einer Stärkung Preußens zum Zwecke der Verwirklichung des Traumes von einem geeinten Deutschen Reich, durchzusetzen. Nur die für Preußen angestrebte Vormachtstellung, so seine Überzeugung, kann die Grundlagen hierfür schaffen. Im November 1863 sollte die Stärke der europäischen Stellung Preußens auf die Probe gestellt werden. Als Friedrich VII. von Dänemark stirbt, geht die Krone des Gesamtstaates an Christian IX. über. So hatten es die Mächte im »Londoner Protokoll« von 1852 bestimmt. Im Ergebnis hebt der dänische König eigenmächtig die Sonderstellung des außerhalb des Deutschen Bundes liegenden Herzogtums Schleswig auf und integriert es in das Königreich Dänemark. Dieses Vorgehen bietet Bismarck nun die Chance, den Konflikt um die Lösung der deutschen Frage an die Peripherie zu verlagern. Er umgeht den Deutschen Bund, indem er Österreich zu einem Eingreifen nötigt, und schafft es in einem diplomatischen Vabanque-Akt und durch den an den Krieg sich anschließenden Wiener Frieden vom 30. Oktober 1864, in einem regional begrenzten Kabinettskrieg, die beiden Elbherzogtümer aus Dänemark herauszulösen. Damit hat er eine nationale Tat vollbracht, wieder einen Schritt hin zu jenem Traum vom Reich, ein reales Ergebnis, das der nationalen und liberalen Bewegung von 1848 versagt geblieben war. Dies stärkt nicht nur die internationale, sondern auch die innenpolitische Stellung des bisher hauptsächlich als »Konfliktministers« wahrgenommenen Bismarck.
Seine überlegene staatsmännische Haltung beweist Bismarck, auch wiederum gegenüber der Opposition, mit der Zurückweisung eines überzogenen anti-dänischen Artikels in der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung vom 7. August 1864, indem er telegraphiert: »Der gereizte und feindliche Ton gegen Dänemark nach dem Siege nicht würdig. Der Kampf nicht aus Hass geführt, sondern für Regelung und Abwehrung. Härte gegen Dänemark nicht beabsichtigt, keine Bedingungen eines übermütigen Siegers, die durch Verletzung berechtigter nationaler Gefühle künftige freundliche Verhältnisse unmöglich machen. Die Abtrennung der Herzogtümer vollständig erlangt. Die genügt… Der Sieger habe keinen Anlaß, Erbitterung zu hegen oder zu provozieren.«
Es kommt zum Streit zwischen Preußen und Österreich um die Verwaltung der befreiten Herzogtümer, bis eine Kompromisslösung dazu führt, dass Preußen schließlich die Verwaltung Schleswigs, Österreich die des Herzogtums Holstein übernimmt. Mit einer Mischung aus militärischer Stärke und diplomatischem Geschick war es so Bismarck gelungen, eine der verwickeltsten europäischen Fragen zu lösen.
1866 schließlich entlädt sich der deutsche Dualismus dann doch in einem Bruderkrieg zwischen Preußen und Österreich, im Ringen um die Vormachtstellung in Europa. Unmittelbar nach dem Abschluss eines deutsch-italienischen Bündnisses am 8. April 1866 beginnt Bismarck mit einer diplomatischen Offensive gegen Österreich. Jetzt will er es wissen, indem er am gleichen Tag im Bundestag in Frankfurt den Antrag stellt, »eine aus direkten Wahlen und allgemeinem Stimmrecht der ganzen Nation hervorgehende Versammlung einzuberufen, um die Vorlagen der deutschen Regierungen über eine Reform der Bundesverfassung entgegenzunehmen und zu beraten.«
Auf diesem Pfad kann der Vielvölkerstaat Österreich den deutschen Ländern nicht folgen, den Weg zu einem nationalen Parlament nicht freimachen, ohne seine eigene staatliche Verfassung in Frage zu stellen. Doch auch im eigenen Lager ruft das Vorgehen Bismarcks, der sich plötzlich des Paulskirchen-Gedankens annimmt, und somit ganz im Gegensatz zu seinem früheren Einsatz gegen die Revolutionäre von 1848/49 zu stehen scheint, Bestürzung hervor – wohl, weil dieser historische Schachzug auch von den Seinen nicht in seiner ganzen Tragweite erfasst wird, sondern nur seine unmittelbaren Auswirkungen. So ruft König Wilhelm bestürzt aus: »Aber das ist ja die Revolution, was sie mir da vorschlagen!«
Am 14. Juni 1866 fällt der unwiderrufliche Beschluss zum Krieg gegen Österreich. Wohl noch unter dem Eindruck eines im Mai gegen ihn, den »bestgehassten Mann« Preußens, verübten Attentats, stehend, verübt durch den Demokraten Cohen-Blind, erklärt Bismarck gegenüber einem englischen Gesandten: »Der Kampf wird ernst werden. Es kann sein, dass Preußen verliert, aber wie es auch kommen mag, es wird tapfer und ehrenvoll kämpfen… Wenn wir geschlagen werden, werde ich nicht hierher zurückkehren. Ich werde bei der letzten Attacke fallen. Man kann nur einmal sterben; und wenn man besiegt wird, ist´s besser zu sterben.« Doch soweit kommt es nicht; die preußischen Truppen können in blutigen Kämpfen den Krieg für sich entscheiden. Vor allem eine Schlacht, die von Königgrätz am 3. Juli 1866, entscheidet über Sieg und Niederlage – hier bringt sie den Sieg Preußens durch die Modernität des preußischen Heeres und die überlegene Führung Moltkes.
Wie schon zuvor gegenüber Dänemark, entsagt Bismarck der Überheblichkeit des überlegenen Siegers. Als unmittelbar nach der Schlacht das österreichische Waffenstillstandsangebot eintrifft, erkennt Bismarck sofort die Chance, die für Preußen entscheidenden Ziele zu erreichen, ohne Feuer an die Lunte zu legen, welche zum Pulverfass für die europäische Ordnung führen würde. Statt Österreich zu demütigen, arbeitet Bismarck die Grundlagen für einen neuen Frieden heraus, wie ausgerechnet der ihm sehr kritisch gegenüberstehende General von Stosch, Vertrauter des Kronprinzen Friedrich Wilhelm, darlegt: „Ausschluß Österreichs aus Deutschland, Einigung des wesentlich protestantischen Deutschlands als Etappe zur großen Einheit… Es war das erstemal, dass ich Bismarck im persönlichen Verkehr sah, und ich bekenne gern, dass der Eindruck, den ich von ihm empfing, mich geradezu überwältigte. Die Klarheit und die Größe seiner Anschauungen boten mir höchsten Genuss; er war sicher und frisch in jeder Richtung, bei jedem Gedanken eine ganze Welt umfassend.«
Damit sind die Voraussetzungen geschaffen für die Gründung des Norddeutschen Bundes, als erstem wichtigen Schritt auf dem Weg zur Einheit Deutschlands. Jetzt ist allerdings die Gefahr einer Auseinandersetzung mit Frankreich gegeben, das sich durch das aufstrebende Preußen bedroht sieht. So muss Bismarck zur Mäßigung aufrufen. Seiner Frau teilt er am 9. Juli 1866 mit: »Uns geht es gut, trotz Napoleon; wenn wir nicht übertrieben in unseren Ansprüchen sind und nicht glauben, die Welt erobert zu haben, so werden wir auch einen Frieden erlangen, der der Mühe Wert ist. Aber wir sind ebenso schnell berauscht wie verzagt, und ich habe die unangenehme Aufgabe, Wasser in den brausenden Wein zu gießen und geltend zu machen, dass wir nicht allein in Europa leben, sondern mit noch drei Mächten, die uns hassen und neiden.«
Der überraschende militärische Erfolg Preußens führt zur Umstimmung der Meinung über Bismarck, zumal da man nunmehr an die Möglichkeiten einer neuen Bundesverfassung unter Preußens Führung glaubt. Im Prager Frieden schont Bismarck die süddeutschen Staaten und »rundet« das preußische Gebiet durch die Einverleibung Hannovers, Kurhessens, Nassaus und der freien Stadt Frankfurt ab.
Der 1867 gegründete Norddeutsche Bund stellte eine neue deutsche Großmacht dar, bereits mit nationalstaatlichem Anspruch. Nach dem Sieg von Königgrätz hatte Bismarck einen Kompromiss mit den Liberalen gefunden, denen er durch die Organisation des Norddeutschen Bundes weit entgegenkommt. Die neue, bundesstaatliche Form dieses Gebildes ist von vorneherein auf die spätere Einbeziehung der derzeit noch souveränen süddeutschen Länder ausgerichtet. Bismarck ist der neue Bundeskanzler dieses Bundes, er ist zugleich der einzige »verantwortliche Minister«, das Präsidium untersteht dem König von Preußen, im Innern herrscht ein allgemeines und gleiches Wahlrecht. Indem Bismarck für die budgetlose Zeit 1862-66 beim Landtag um nachträgliche Bewilligung nachsucht, beseitigt er zudem einen alten Konflikt zwischen Krone und Parlament und findet nunmehr bei der bisherigen Opposition, den Nationalliberalen, kräftige Unterstützung.
Nach dem Sieg über Österreich und der Errichtung des Norddeutschen Bundes ergibt sich im Politischen ein Phase der Konsolidierung, die Bismarck als notwendig erachtet, aber auch im Privaten eine gewisse Beruhigung. Von der ihm vom preußischen Abgeordnetenhaus bewilligten Dotation von 400.000 Talern kauft Bismarck 1867 das vorpommersche Rittergut Varzin (im Kreise Rummelsburg), das 22 500 Morgen, davon mehr als die Hälfte Wald, umfaßt; Kniephof verkauft er. In den darauffolgenden zwei Jahren zieht sich Bismarck von Berlin oft dorthin zurück – meist für mehrere Monate: Hier erreicht mich kein Depeschenbote«.
Unterdessen wachsen die Begehrlichkeiten Frankreichs, welches gewissermaßen im Nachhinein eine Kompensation für den großen Machtzuwachs Preußens anstrebt. Trotzdem zögert Bismarck diesmal, die militärische Entscheidung zu suchen. Diejenigen, die heute Bismarck auf die »Blut-und-Eisen-Politik« reduzieren und sich dabei immer wieder auf das o.g. Zitat aus dem preußischen Landtag berufen, ignorieren dies in ihrer Betrachtung. Die nationaldeutsche Bewegung drängte in jenen Jahren zu einer Entscheidung, in der nicht nur Frankreichs Ansprüche zurechtgestutzt, sondern auch die Vereinigung mit den süddeutschen Ländern vorangetrieben werden sollte. Doch Bismarck warnt im Mai 1868: »Wir alle tragen die nationale Einigung im Herzen, aber für den rechnenden Politiker kommt zuerst das Notwendige und dann das Wünschenswerte.« An anderer Stelle äußert er sich grundsätzlicher zum Kriegsgedanken: »Man darf nicht Krieg führen, wenn es mit Ehren zu vermeiden ist. Die Chance günstigen Erfolges ist keine gerechte Ursache, einen großen Krieg anzufangen.« Erst als Bismarck erkennen muss, dass Frankreich die friedliche Vollendung der deutschen Einheit unter keinen Umständen zulassen würde und dass man dort nur auf einen Kriegsgrund wartet, in der Hoffnung man könne Preußen isolieren, und auf die Neutralität der süddeutschen Länder setzen, erst da nahm Bismarck den Fehdehandschuh auf.
Wie sehr Bismarck mit sich selbst gehadert haben muss, als es zum Beispiel darum ging, aus dem Süden Deutschlands das zum Anschluss an den Norddeutschen Bund bereite Baden aufzunehmen, und trotzdem gegenüber den Nationalliberalen immer wieder für ein geduldiges Warten plädierte, wenn diese den nächsten Schritt einfordern, macht sein Entlassungsgesuch an König Wilhelm deutlich, das dieser jedoch mit den Worten ablehnt: »Ihr Name steht in Preußens Geschichte höher als der irgendeinen preußischen Staatsmannes. Den soll ich lassen? Niemals!«
Letztlich ist es dann eine dynastische Frage, welche die Gelegenheit zur militärischen Zerschlagung des gordischen Knotens bietet, indem ein französisch-preußischer Eklat über die Besetzung des spanischen Throns 1870 zum Deutsch-Französischen Krieg führt. Durch einen geradezu genialen Schachzug, der als »Emser Depesche« in die Geschichte eingeht, erreicht Bismarck, dass Frankreich die Kriegserklärung ausspricht. Hierdurch ist der Bündnisfall eingetreten und somit kann jener äußere Druck erzeugt werden, der notwendig war, um auch die süddeutschen Länder auf Seiten des Norddeutschen Bundes in das Kriegsgeschehen einzubinden; jetzt sind zumindest die nicht-österreichischen deutschen Länder im Kriege vereint.

Dass es sich hierbei, auch wenn trickreich von Bismarck herbeigeführt, dennoch nicht um eine deutsche Aggression handelte, sah selbst Bismarcks DDR-Biograph Ernst Engelberg so, wonach Deutschland solange einen gerechten Verteidigungskrieg führte, wie der französische Bonapartismus nicht besiegt war. Napoleon III., als Exponent des Bonapartismus und seinem Vorbild Napoleon I. nacheifernd, war von diesem inneren Zwang getrieben, Frankreichs Grenze nach Osten vorzuschieben, also Expansionspolitik nach Deutschland hinein zu betreiben.
Der Deutsch-Französische Krieg findet schließlich seine Vorentscheidung in der Schlacht von Sedan am 1. September 1870, mit der Kapitulation der französischen Truppen und der Gefangennahme des französischen Kaisers Napoléon III. am 2. September 1870. Doch nicht nur im Hinblick auf den Krieg, auch über das zweite französische Kaiserreich ist mit dem Sieg von Sedan eine Entscheidung gefallen. Schon am Tag danach erhebt sich in der Hauptstadt Paris das Volk und kurz darauf kommt es vor dem Rathaus zur Ausrufung der Republik.
Noch während des Krieges erklärt Bismarck am 16. September 1870, dass Deutschland die Abtretung von Elsaß und Lothringen als Bürgschaft gegen neue Angriffsgelüste verlangt.
Es ist vollbracht!
Der gemeinsam errungene Sieg über Frankreich führt am 18. Januar 1871 zur Gründung des Deutschen Reiches. Wilhelm I. wird im Spiegelsaal von Versailles zum deutschen Kaiser proklamiert und der einheitliche deutsche Nationalstaat ausgerufen.
Bismarck verliest die von ihm entworfene Proklamation Wilhelms I., die mit der Wendung schließt, dass er die Kaiserwürde in dem Bewusstsein der Pflicht übernommen habe, »den Frieden zu wahren, die Unabhängigkeit Deutschlands, gestützt auf die geeinte Kraft seines Volkes, zu verteidigen. Uns aber und Unseren Nachfolgern an der Kaiserkrone wolle Gott verleihen, allzeit Mehrer des Deutschen Reiches zu sein, nicht an kriegerischen Eroberungen, sondern an den Gütern und Gaben des Friedens auf dem Gebiet nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung.«
Otto von Bismarck wird zum ersten Reichskanzler des neugeschaffenen Nationalstaates. Ein erblicher Fürstenstand wird etabliert und der Frankfurter Friede vom 10. Mai 1871 beendet den Deutsch-Französischen Krieg. Die Delegationsleiter Frankreichs und Deutschlands, Jules Favre und Otto von Bismarck unterzeichnen im »Schwanenhotel« in Frankfurt/M den Friedensvertrag. Die Provinz Elsaß-Lothringen wird Bestandteil des Deutschen Reiches und Frankreich muss 5 Milliarden Franc Kriegsentschädigung zahlen. Otto von Bismarck erhält am 21. März 1871 die nach dem Recht der Erstgeburt erbliche Fürstenwürde und eine große Domäne in Lauenburg mit dem Sachsenwald. »Friedrichsruh«, wie er den Platz nennt, auf den er sich in den folgenden Jahren immer häufiger bei seinen vielen physisch, psychisch oder auch »diplomatisch« begründeten Krankheiten zurückzieht, hat es ihm angetan, er bezeichnet diesen Rückzugsort als »Ideal meiner Träume«.
Mit der Verabschiedung der Verfassung des Deutschen Reiches am 16. April 1871 ist der Akt der Reichsgründung nun auch formal endgültig abgeschlossen, und Bismarck führt von nun an den Titel des Reichskanzlers, als einziger verantwortlicher Minister des Reiches, in Personalunion mit der Funktion des Ministerpräsidenten und Ministers des Auswärtigen des stärksten Bundesstaates Preußen.
In den folgenden Jahren der Konsolidierung und Sicherung der europäischen Großmachtstellung des Deutschen Reiches wird Deutschland aufgrund seiner Größe, seiner militärischen Stärke und der rasant wachsenden Industrialisierung zur stärksten politischen und wirtschaftlichen Macht in Europa.
Der Kampf um die innere Einheit
Nachdem es Bismarck gelungen war, die wohl größte Aufgabe unserer politischen Geschichte zu lösen – die Schaffung eines einheitlichen Reiches der Deutschen – wird offenbar, dass sich in der Zwischenzeit, und nachdem das nationale Hochgefühl der militärischen Siege abgeklungen ist, gefährliche Gegensätze innerhalb des deutschen Volkes aufgetan haben. In dem nun folgenden Kulturkampf mit der katholischen Kirche erhebt sich aus der religiösen Spaltung des Volkes eine neue Gefahr für die nationale Einheit. Am 14. Mai 1872 erklärt Bismarck im Reichstag, im Bündnis mit den Liberalen, gegen die katholische Kirche und gegen die Zentrumspartei gerichtet: »Seien Sie außer Sorge: Nach Canossa gehen wir nicht.«
Hintergrund war, dass sich nach dem Herausdrängen des katholisch geprägten Österreichs ein Übergewicht des Protestantismus entstanden war und sich die konfessionellen Minderheiten in Deutschland im Gegensatz zum protestantischen Kaisertum des neuen Reiches sahen.
Das war ein Konflikt, den Bismarck selbst durch sein kompromissloses Auftreten unnötig verschärft, der aber auch neue Dynamik gewinnt durch ein Pistolen-Attentat am 13. Juli 1874, den der katholische Böttchergeselle Eduard Kullmann (1853-1892) in Kissingen auf Bismarck verübt, bei dem dieser leicht am rechten Handgelenk verwundet wird. Obwohl sich die Zentrumspartei kurz darauf von dem Täter distanziert, trägt der Vorfall wesentlich zur Verschärfung des Kulturkampfes bei. Kullmann wird im Oktober 1874 zu 14 Jahren Zuchthaus verurteilt.
Bedrohlicher für den neuen Staat ist der Umstand, dass die im Zuge der Industrialisierung enorm gewachsene Zahl der Industriearbeiter in ihrer Masse nicht für den neuen Staat gewonnen werden konnte. Bismarck muss hier den Umgang mit einem Stand erlernen, der ihm selbst, auf dem Lande groß geworden und von agrarischem, naturverbundenen Denken geprägt, fremd ist und dessen Bedürfnisse er zunächst nicht in vollem Umfang einzuschätzen vermag.
Die neue Gefahr, die Bismarck aus dem Aufstieg der organisierten Arbeitermassen und aus den »gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie« erwächst, wird von ihm konsequent bekämpft. Dies gipfelt in einem entsprechenden Reichsgesetz, dem sogenannten »Sozialistengesetz« vom 18. Oktober 1878, mit dem Bismarck das seit 1874 von ihm geforderte Verbot der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAP) durchsetzt. Was ihm damit nicht gelingt, das ist die Zerschlagung der Sozialdemokratie. Dieses Beispiel lehrt wohl, dass eine Bewegung, die gesellschaftspolitisch die richtigen Fragen stellt und dabei die Bedürfnisse der Massen aufgreift, durch Verbote nicht aufzuhalten ist, auch nicht wenn ihr Widerpart eine Persönlichkeit wie Bismarck ist.
Weitaus wirkungsvoller zur inneren Befriedung des Reiches sind die sozialpolitischen Reformen, die Bismarck vorantreibt, um das Los breiter Bevölkerungsschichten zu verbessern. Am 17. Juli 1878 beginnt Bismarck schrittweise mit dem Ausbau eines umfangreichen staatlichen Fürsorge- und Wohlfahrtsystems, mit der sogenannten Arbeiterschutz-Novelle, mit der die obligatorische Fabrikaufsicht durch staatliche Fabrikinspektoren eingeführt wird. Es folgen die in ihren Grundzügen bis heute gültigen drei großen Bismarckschen Sozialgesetze: das Krankenversicherungsgesetz 1883, das Unfallversicherungsgesetz 1884 und das Gesetz über die Invaliditäts- und Altersversicherung 1889.
»Geben Sie dem Arbeiter das Recht auf Arbeit, solange er gesund ist, sichern Sie ihm Pflege, wenn er krank ist, sichern Sie ihm Versorgung, wenn er alt ist.«
Quelle: Im Reichstag zur geplanten Sozialversicherung, 1881
Diese Gesetzgebung entspringt letztlich nicht dem Parteienhader oder dem weltanschaulichen Kampf, dem Bismarck nachgeben muss, sondern einem über den politischen Fraktionen stehenden staatlichen Fürsorgepflicht des preußischen Königtums, dessen Aufgabe Bismarck darin sieht, der immanenten Gegensätze des Volkes Herr zu werden, da sonst sein außenpolitisches Werk gefährdet gewesen wäre. Am Ende weiß Bismarck den deutschen Arbeiter besser versorgt als dessen Standesgenossen in den anderen großen Industriestaaten. Als Bismarck am 15. September 1880 das preußische Handelsministerium übernimmt, kündigt er die Abkehr von der bisherigen »Laissez Faire«-Politik an, und stellt dieser eine Politik des ordnenden staatlichen Eingriffs gegenüber.
Das Bismarcksche Bündnissystem
Unterdessen arbeitet Bismarck außenpolitisch weiter an der Etablierung eines Bündnissystems. Fußend auf dem Gedanken eines saturierten Deutschlands in der Mitte Europas trachtet er danach, ein europäisches Gleichgewicht der Mächte herzustellen. Gleichzeitig sollte ein mögliches, französisch-russisches Bündnis verhindert werden. Das sogenannte Drei-Kaiser-Abkommen vom 22. Oktober 1873 zwischen Österreich, Rußssland und dem Deutschen Reich schafft die Voraussetzungen für eine solche Ordnung.
Dieses Gleichgewicht scheint bedroht, als es Frankreich gelingt, die ihm auferlegten Kriegsentschädigungen vorzeitig abzuzahlen und militärisch schneller als erwartet, wieder erstarkt. Bismarck versucht, Frankreich einzuschüchtern, womit er aber nicht so erfolgreich ist, wie erhofft. Durch einen von ihm initiierten Zeitungsartikel unter der Überschrift »Ist der Krieg in Sicht?« provoziert Bismarck 1875 die sogenannte »Krieg-in-Sicht-Krise«. Er will vor allem die verbündeten Mächte Deutschlands auf den Plan rufen. Doch der Kitt zwischen den drei Ostmächten ist nicht so stark, wie erhofft. Schließlich kann die Krise beigelegt werden.
Bismarcks pro-russische Politik, die dieser schon seit seiner Zeit in St. Petersburg kultiviert hat, findet ihre Fortsetzung im sogenannten »Kissinger Diktat« vom 15. Juni 1877, in dem er sich für die russische Schwarzmeerherrschaft ausspricht. Sein Vorschlag: Das Deutsche Reich sei lediglich an der Erhaltung des status quo interessiert, Großbritannien hingegen solle Ägypten erhalten. Hier wird das Ziel Bismarcks, die Schaffung eines europäischen Mächtegleichgewichts, deutlich, bei dem einseitige Beziehungen zu einzelnen Mächten vermieden werden und der europäische Friede gesichert werden soll.
Mehr und mehr wird die künftige Rolle Deutschlands sichtbar, die das Deutsche Reich nach dem Willen Bismarcks einnehmen soll. Er prägt den Begriff vom »ehrlichen Makler«, als er am 19. Februar 1878 vor dem Reichstag erklärt, in der Orientkrise vermitteln zu wollen, wie auch in der Balkan-Krise, zu deren Befriedung er im Juni 1878 den Berliner Kongress einberuft.

Unterdessen rückt die Kolonialfrage, vor allem im Hinblick auf den afrikanischen Kontinent, immer stärker in den Vordergrund. Bismarck steht kolonialen Abenteuern des Reiches desinteressiert bis ablehnend gegenüber; für ihn ist die Kolonialpolitik nur insofern von Bedeutung, als sie insgesamt gesehen in der Politik der europäischen Großmächte eine immer größere Rolle spielt. Am 24. April 1884 wird, mit Unterstützung von Bismarck, Angra Pequena, die erste Kolonialerwerbung, unter deutschen Schutz gestellt und am 15. November beruft Bismarck gemeinsam mit dem französischen Ministerpräsidenten Ferry die Kongokonferenz in Berlin ein. In der sogenannten Kongo-Akte einigen sich 13 europäische Staaten und die Vereinigten Staaten von Amerika und über die Zollfreiheit im Kongo- und Nigergebiet sowie die Errichtung eines Kongostaates unter dem belgischen König Leopold II. Während in diesem Dokument der Anspruch der europäischen Mächte, Afrika untereinander aufzuteilen, festgeschrieben wird, stellt Otto von Bismarck 1888 gegenüber dem Afrikaforscher Eugen Wolf sein eigentliches Interesse klar: »Ihre Karte von Afrika ist ja sehr schön, aber meine Karte von Afrika liegt in Europa. Hier liegt Russland und hier liegt Frankreich, und wir sind in der Mitte; das ist meine Karte von Afrika.«
Die erneut aufbrechende Orientkrise des Jahres 1888 bringt insofern eine neue Gefahr für das Reich, als hier die Möglichkeit eines Bruchs mit Russland gegeben ist, der u.a. von der Wiener Regierung in Kauf genommen zu werden droht. Doch Bismarck verdeutlicht wieder seine außenpolitische Maxime des Ausgleichs mit Russland und der europäischen Friedenssicherung, indem er erklärt: »Es ist uns vollständig gleichgültig, wer in Bulgarien regiert und was aus Bulgarien überhaupt wird – das wiederhole ich hier; ich wiederhole alles, was ich früher mit dem viel missbrauchten und totgerittenen Ausdruck von den Knochen des pommerschen Grenadiers gesagt habe: die ganze orientalische Frage ist für uns keine Kriegsfrage. Wir werden uns wegen dieser Frage von niemand das Leitseil um den Hals werfen lassen, um uns mit Russland zu brouillieren.«
Doch die kluge Außenpolitik Bismarcks droht – nicht zuletzt durch innenpolitische Differenzen – in Frage gestellt zu werden, als mit der Thronbesteigung Wilhelms II. am 15. Juni 1888 das sich seit den 1870er Jahren nahezu unverändert bestehende Machtgefüge an der Spitze des Reiches aufzulösen beginnt: Der junge Kaiser ist, ganz im Gegensatz zu seinem Großvater Wilhelm I. nicht länger gewillt, sich dem Willen des Kanzlers unterzuordnen.
Als Wilhelm II. beginnt, Pläne für eine eigene Sozialpolitik zu entwickeln, die unter anderem ein breit angelegtes Programm zur Verbesserung des Arbeiterschutzes vorsehen, und Bismarcks Vorlage für ein unbefristetes Sozialistengesetz im Reichstag abgelehnt wird, tritt dieser von dem für die Sozialpolitik zuständigen Amt des preußischen Handelsministers zurück. Weitere Meinungsverschiedenheiten treten hinzu. Bismarcks Festhalten an einer Kabinettsordre von 1852, die den Verkehr der einzelnen Minister mit der Krone unter die Kontrolle des Ministerpräsidenten stellt, führt zum Bruch zwischen Kaiser Wilhelm II. und Bismarck. In einer Unterredung fordert Wilhelm II. Bismarck schließlich unumwunden zum Rücktritt auf.
Der Meister tritt ab
Am 18. März 1890 reicht Bismarck sein Abschiedsgesuch ein, das allerdings so geschickt formuliert ist, dass dem Kaiser die ganze Verantwortung für das Zerwürfnis zufällt. Der Wortlaut des Gesuchs wird erst unmittelbar nach Bismarcks Tod bekannt.
Am 20. März 1890 wird Bismarcks als Reichskanzler und preußischer Ministerpräsident offiziell entlassen. Bismarck erhält den Titel eines Herzogs von Lauenburg, den zu tragen er sich jedoch weigert. In weiten Teilen der deutschen Öffentlichkeit herrscht zunächst Erleichterung über Bismarcks Sturz. Im Ausland hingegen wird der Machtwechsel mit gemischten Gefühlen aufgenommen, da Bismarck als Garant einer friedlichen Außenpolitik gilt. Von Friedrichsruh aus kommentiert und kritisiert der »Alte vom Sachsenwald«, wie Bismarck nun genannt wird, unablässig die Politik seines Nachfolgers Leo von Caprivi und des Kaisers.
Am 30. April 1891 gelingt Bismarck ein Husarenstück, als er sich als Kandidat der Nationalliberalen in den Reichstag wählen lässt. Zwar übt er das Mandat nie aus, erfreut sich aber an der politischen Unruhe, die dieser Schachzug auslöst. Jetzt hätte es ruhig werden können um Bismarck, wenn nicht Wilhelm II. ihm ungewollt zu neuer Popularität verholfen hätte: Der kaiserliche Erlass schneidet Bismarck offiziell von fast alle Kontakten ab. Der daraufhin einsetzende Sturm der Entrüstung, der sich in der Öffentlichkeit Bahn bricht, war so wohl weder vom Kaiser noch den innenpolitischen Gegnern Bismarcks erwartet worden. Erst diese Desavouierung des »Reichsgründers« begründet einen regelrechten Kult um den Eisernen Kanzler. Als es im Jahre 1894 zu einer offiziellen Aussöhnung mit Kaiser Wilhelm II. kommt, ist Bismarck bereits ein lebendes Denkmal. Echte Bismarckdenkmäler werden jedoch schon seit 1868 zu Ehren Otto von Bismarcks an vielen Orten des damaligen Deutschlands, aber auch in den Kolonien, errichtet, jetzt nimmt diese Bewegung richtig Fahrt auf und führt, verstärkt ab 1899, zur Errichtung unzähliger Bismarcktürme.
Am 27. November 1894 verstirbt Bismarcks Frau Johanna, geb. von Puttkamer. Nach dem Tode der Fürstin ordnet Bismarck an, seine Gefährtin möge ihre letzte Ruhe an der Stätte ihres Todes finden, wo das Paar viele Sommer und Winter verlebt hatte. Ein kleines Gartenhaus, das ein Lieblingsplatz der Fürstin war, wird zu einer einfachen Grabkapelle umgewandelt, und hier wird der Sarg beigesetzt. Später wird ihre Leiche nach Friedrichsruh verbracht, wo sie an der Seite ihres Gatten bestattet ist. Tatsächlich war die Gemahlin Otto von Bismarcks nicht nur für ihn, sondern eine für das Deutsche Reich und dessen Gründung herausragend wichtige Persönlichkeit. Sie gab ihm den Halt, den er benötigte, um sein Titanenwerk zu errichten. Bismarck selbst formulierte es so: »Du bist der Anker an der guten Seite des Ufers« und weiter: »Reißt der, so sei Gott meiner Seele gnädig.«
In der Tat wird es jetzt einsam um den Reichsgründer. Am 23. März 1895 lehnt die Reichstagsmehrheit eine Glückwunschadresse zu Bismarcks 80. Geburtstag ab. Zu oft und zu scharf hatte er Kritik an der Politik des Reichskanzlers und des Parlaments geübt. Gleichzeitig erreicht allerdings die Verehrung Bismarcks im Volk einen weiteren Höhepunkt: Über 450 Städte verleihen Bismarck die Ehrenbürgerschaft, 9 875 Telegramme und 450 000 Briefe werden vom Postamt in Friedrichsruh ausgeliefert und Tausende pilgern zu Bismarcks Ruhesitz.
Als Bismarck am 24. Oktober 1896 in den Hamburger Nachrichten den von 1887 bis 1890 bestehenden geheimen deutsch-russischen Rückversicherungsvertrag offenbart, der allerdings von Kaiser Wilhelm II. nicht verlängert wurde, wird einmal mehr deutlich, wie vorausschauend der Eiserne Kanzler in der Zeit, in der er die Verantwortung trug, gehandelt hatte.
Schon im Jahre 1888 hatte Bismarck sich schon einmal grundsätzlich zum Problem eines Krieges gegen Russland geäußert und damit zugleich den notwendigen Rückhalt des Deutschen Reiches in einem Bündnis mit Russland betont: »Ein Sieg über Russland ist keine Zertrümmerung, sondern nur die Herstellung eines revanchebedürftigen Nachbarn auch im Osten.« Ein einmal begonnener Krieg gegen Russland sei somit gar nicht siegreich zu beenden, denn: »Selbst der günstigste Ausgang des Krieges würde niemals die Zersetzung der Hauptmacht Russlands zur Folge haben… Dieses unzerstörbare Reich russischer Nation, stark durch sein Klima, seine Wüsten und seine Bedürfnislosigkeit, wie durch den Vorteil, nur eine schutzbedürftige Grenze zu haben, würde nach seiner Niederlage unser geborener und revanchebedürftiger Gegner bleiben, genau wie Frankreich es im Westen ist.«
Auch sonst zielt Bismarcks Außenpolitik nicht darauf ab, irgendeine der europäischen Großmächte in Frage zu stellen, auch wenn die Möglichkeit dazu bestanden hätte. So sieht er andererseits den Ausgleich mit Frankreich und Österreich als Notwendigkeit an, um nicht in eine einseitige Abhängigkeit von England zu geraten: »Frankreichs Fortbestehen als Großmacht ist für uns ebenso ein Bedürfnis wie das jeder anderen Großmächte, allein schon, weil wir für gewisse Fälle eines maritimen Gegengewichts zur See gegen England bedürfen.«
Heimgang
Dieser kluge Staatsmann, der die Prinzipien von »Eisen und Blut« ebenso kannte wie Frieden und Ausgleich, der in seinem Charakter gewaltige Leidenschaften der Liebe und des Hasses vereinte, diese für das Schicksal der Deutschen nach wie vor kaum fassbare Persönlichkeit, verstirbt am 30. Juli 1898 auf seinem Gut Friedrichsruh bei Hamburg. Dort findet auch die Beisetzung Otto von Bismarcks gemäß seinen eigenen Vorgaben statt; die Familie kommt dem Wunsch Kaiser Wilhelms II., den Leichnam nach Berlin zu überführen, nicht nach.
Schon im November 1898 erscheinen die ersten zwei Bände von Bismarcks Gedanken und Erinnerungen; die ersten 100 000 Exemplare sind nach kürzester Zeit vergriffen. Der dritte Band, der die Umstände der Entlassung Bismarcks schildert, darf erst 1919, nach dem Sturz der Hohenzollernmonarchie, veröffentlicht werden. Von den über 700 Bismarck-Denkmälern, die bis 1914 im Deutschen Reich in Planung sind, werden mindestens 500 realisiert.
Im Jahre 2012 werden bislang verschollen geglaubte Tonaufzeichnungen Bismarcks veröffentlicht, die 1889 mit dem Phonographen des amerikanischen Erfinders Thomas Edison entstanden waren. Anhand dieser Aufzeichnungen konnte auch mit eine der vielen Falschdarstellungen über Bismarck aufgeräumt werden, die in der Darstellung bestand, der Eiserne Kanzler habe trotz seines voluminösen Körperbaus (bei 1,90 Meter Größe wog er bis zu 125 Kilo) eine Fistelstimme gehabt. Es waren wohl neiderfüllte Zeitgenossen, die die rhetorische Urgewalt Bismarcks, wenn schon nicht in inhaltlicher, so doch wenigstens in stimmlicher Hinsicht in Frage stellen wollten. Diese Legende fand sogar Eingang in Schulbücher und Lexika, wie so viele Legenden. Doch irgendwann bricht sich die Wahrheit immer Bahn.
Dieser Beitrag stammt aus dem Taschenkalender des nationalen Widerstandes für das Jahr 2015, erschienen im Deutsche Stimme Verlag.
Quellen:
Willy Andreas und Wilhelm von Scholz: Die Großen Deutschen. Neue Deutsche Biographie, Dritter Band. Propyläen-Verlag, Berlin 1936
Andreas Hillgruber: Persönlichkeit und Geschichte. Otto von Bismarck. Muster-Schmidt Verlagsgesellschaft, Göttingen – Zürich 1978
Otto Pflanze: Bismarck. Der Reichskanzler. C.H. Beck´sche Verlagsbuchhandlung (Oscar Beck), München 1998; Titel der amerikanischen Originalausgabe: Bismarck and the Development of Germany
Mario Kandil: Bismarck – Der Aufstieg 1848-1871. Hohenrain-Verlag, Tübingen 2014
Lothar Gall und Karl-Heinz Jürgens: Bismarck – Lebensbilder. Gustav Lübbe Verlag GmbH, Bergisch Gladbach 1990